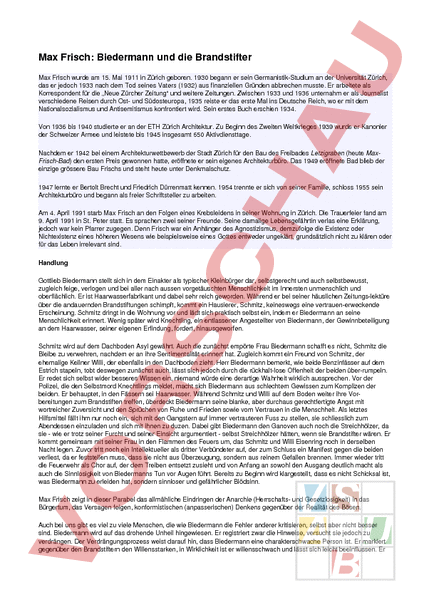Arbeitsblatt: Biedermann und die Brandstifter
Material-Details
Angaben zu Werk und Autor
Deutsch
Textverständnis
9. Schuljahr
3 Seiten
Statistik
94994
1676
20
26.02.2012
Autor/in
re (Spitzname)
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Max Frisch: Biedermann und die Brandstifter Max Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich geboren. 1930 begann er sein GermanistikStudium an der Universität Zürich, das er jedoch 1933 nach dem Tod seines Vaters (1932) aus finanziellen Gründen abbrechen musste. Er arbeitete als Korrespondent für die „Neue Zürcher Zeitung und weitere Zeitungen. Zwischen 1933 und 1936 unternahm er als Journalist verschiedene Reisen durch Ost und Südosteuropa, 1935 reiste er das erste Mal ins Deutsche Reich, wo er mit dem Nationalsozialismus und Antisemitismus konfrontiert wird. Sein erstes Buch erschien 1934. Von 1936 bis 1940 studierte er an der ETH Zürich Architektur. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 wurde er Kanonier der Schweizer Armee und leistete bis 1945 insgesamt 650 Aktivdiensttage. Nachdem er 1942 bei einem Architekturwettbewerb der Stadt Zürich für den Bau des Freibades Letzigraben (heute Max FrischBad) den ersten Preis gewonnen hatte, eröffnete er sein eigenes Architekturbüro. Das 1949 eröffnete Bad blieb der einzige grössere Bau Frischs und steht heute unter Denkmalschutz. 1947 lernte er Bertolt Brecht und Friedrich Dürrenmatt kennen. 1954 trennte er sich von seiner Familie, schloss 1955 sein Architekturbüro und begann als freier Schriftsteller zu arbeiten. Am 4. April 1991 starb Max Frisch an den Folgen eines Krebsleidens in seiner Wohnung in Zürich. Die Trauerfeier fand am 9. April 1991 in St. Peter statt. Es sprachen zwei seiner Freunde. Seine damalige Lebensgefährtin verlas eine Erklärung, jedoch war kein Pfarrer zugegen. Denn Frisch war ein Anhänger des Agnostizismus, demzufolge die Existenz oder Nichtexistenz eines höheren Wesens wie beispielsweise eines Gottes entweder ungeklärt, grundsätzlich nicht zu klären oder für das Leben irrelevant sind. Handlung Gottlieb Biedermann stellt sich in dem Einakter als typischer Kleinbürger dar, selbstgerecht und auch selbstbewusst, zugleich feige, verlogen und bei aller nach aussen vorgetäuschten Menschlichkeit im Innersten unmenschlich und oberflächlich. Er ist Haarwasserfabrikant und dabei sehr reich geworden. Während er bei seiner häuslichen Zeitungslektüre über die andauernden Brandstiftungen schimpft, kommt ein Hausierer, Schmitz, keineswegs eine vertrauenerweckende Erscheinung. Schmitz dringt in die Wohnung vor und lädt sich praktisch selbst ein, indem er Biedermann an seine Menschlichkeit erinnert. Wenig später wird Knechtling, ein entlassener Angestellter von Biedermann, der Gewinnbeteiligung an dem Haarwasser, seiner eigenen Erfindung, fordert, hinausgeworfen. Schmitz wird auf dem Dachboden Asyl gewährt. Auch die zunächst empörte Frau Biedermann schafft es nicht, Schmitz die Bleibe zu verwehren, nachdem er an ihre Sentimentalität erinnert hat. Zugleich kommt ein Freund von Schmitz, der ehemalige Kellner Willi, der ebenfalls in den Dachboden zieht. Herr Biedermann bemerkt, wie beide Benzinfässer auf dem Estrich stapeln, tobt deswegen zunächst auch, lässt sich jedoch durch die rückhaltlose Offenheit der beiden überrumpeln. Er redet sich selbst wider besseres Wissen ein, niemand würde eine derartige Wahrheit wirklich aussprechen. Vor der Polizei, die den Selbstmord Knechtlings meldet, macht sich Biedermann aus schlechtem Gewissen zum Komplizen der beiden. Er behauptet, in den Fässern sei Haarwasser. Während Schmitz und Willi auf dem Boden weiter ihre Vor bereitungen zum Brandstiften treffen, überdeckt Biedermann seine blanke, aber durchaus gerechtfertigte Angst mit wortreicher Zuversicht und den Sprüchen von Ruhe und Frieden sowie vom Vertrauen in die Menschheit. Als letztes Hilfsmittel fällt ihm nur noch ein, sich mit den Gangstern auf immer vertrauteren Fuss zu stellen, sie schliesslich zum Abendessen einzuladen und sich mit ihnen zu duzen. Dabei gibt Biedermann den Ganoven auch noch die Streichhölzer, da sie wie er trotz seiner Furcht und seiner Einsicht argumentiert selbst Streichhölzer hätten, wenn sie Brandstifter wären. Er kommt gemeinsam mit seiner Frau in den Flammen des Feuers um, das Schmitz und Willi Eisenring noch in derselben Nacht legen. Zuvor tritt noch ein Intellektueller als dritter Verbündeter auf, der zum Schluss ein Manifest gegen die beiden verliest, da er feststellen muss, dass sie nicht aus Überzeugung, sondern aus reinem Gefallen brennen. Immer wieder tritt die Feuerwehr als Chor auf, der dem Treiben entsetzt zusieht und von Anfang an sowohl den Ausgang deutlich macht als auch die Sinnlosigkeit von Biedermanns Tun vor Augen führt. Bereits zu Beginn wird klargestellt, dass es nicht Schicksal ist, was Biedermann zu erleiden hat, sondern sinnloser und gefährlicher Blödsinn. Max Frisch zeigt in dieser Parabel das allmähliche Eindringen der Anarchie (Herrschafts und Gesetzlosigkeit) in das Bürgertum, das Versagen feigen, konformistischen (anpasserischen) Denkens gegenüber der Realität des Bösen. Auch bei uns gibt es viel zu viele Menschen, die wie Biedermann die Fehler anderer kritisieren, selbst aber nicht besser sind. Biedermann wird auf das drohende Unheil hingewiesen. Er registriert zwar die Hinweise, versucht sie jedoch zu verdrängen. Der Verdrängungsprozess weist darauf hin, dass Biedermann eine charakterschwache Person ist. Er markiert gegenüber den Brandstiftern den Willensstarken, in Wirklichkeit ist er willensschwach und lässt sich leicht beeinflussen. Er zeigt die typischen Merkmale eines Opportunisten ( jemand, der keine eigene Meinung hat und sich in allen Situationen anpasst und daraus Vorteile für sich erwirkt). Dem Gesetz gegenüber ist er nur ein kleiner Spiessbürger. Die Brandstifter kennen diese Art von Menschen genau, wissen, wie man mit ihnen umzugehen hat, und nutzen dies stets aus. Die Ironie besteht darin, dass die Brandstifter Biedermann jeden ihrer Schritte mitteilen. Er kann das Gesetz nicht einschalten, da die Lagerung von Benzinfässern in dieser Zeit der Brandstiftungen verboten ist. Das einzige, was Biedermann den Brandstiftern entgegenzusetzen hat, sind seine eigene Verlogenheit, sein missglückter Humor, seine Verdrängung von Problemen und seine daraus resultierende Verzweiflung, die aus der Einsicht entsteht, am Ende zu sein. Die Brandstifter durchschauen ihn jedoch (wie immer) und treiben ihr Spiel mit ihm; sie fordern alle Accessoires bei Tisch, die er vorher bewusst abräumen liess. Die einzige, die sich unbehaglich fühlt und teilweise Widerstand leistet, ist Babette. Interpretation Schmitz schmeichelt sich bei Biedermann ein und berichtet ihm, dass er den Zirkus, seinen alten Arbeitsplatz, in Brand gesteckt habe. Da sein Vater Köhler war, wurde Schmitz mit dem Feuer gross. Er hat Spass am Feuer, am Knistern und den Funken. Sein Handeln ist durch Freude am Feuer motiviert. Er gesteht, dass er Brandstifter ist, doch Biedermann will dies nicht wahrhaben. Eine Parallele zum NSRegime ist zu erkennen, da es in ähnlicher Weise vorging. Hitler versprach Arbeitsplätze, verschwieg aber seine wahren Absichten nicht, die Folgen daraus kennen wir. Biedermann versteckt den Brandstifter gegenüber seiner Frau und weist ihm einen Schlafplatz auf dem Dachboden zu. Ohne eine Antwort zu bekommen, versichert sich Biedermann nochmals, ob Schmitz auch wirklich kein Brandstifter ist. Biedermann verschliesst die Augen vor jeder Realität und geht zu Bett. Ohne es zu begreifen, hat Biedermann sich seinem schlechten Gewissen gestellt, indem er versucht, Schmitz zu ver stecken. Der edle und menschliche Helfer, der er gerne sein möchte, begibt sich direkt in die Hand des Bösen, vor dem er sich stets fürchtet. Der Auftritt von Schmitz im Schafsfell ist eine ironische Darstellung des Autors. Der Wolf im Schafspelz spiegelt die wahre Identität von Schmitz wieder. Er ist nach aussen hin das arme fromme Lamm, aber der böse Wolf, der in ihm steckt, kann durch das naive Handeln Biedermanns sein teuflisches Werk in Angriff nehmen. Der bürgerliche Biedermann geht keine Verpflichtungen ein. Er lässt sich von seiner Frau vertreten, um Schmitz hinauszuwerfen. Dies gelingt ihr jedoch aufgrund der Redegewandtheit und Sentimentalität von Schmitz nicht. Anstatt Knechtling, der der eigentliche Erfinder des Haarwassers ist, am Profit zu beteiligen, lässt er ihn durch seine Frau entlassen. Biedermann handelt feige, er geht den Weg des geringsten Widerstands und hofft, dass er von allem Unrechten verschont bleibt. Die Benzinfässer auf Biedermanns Dachboden, von Schmitz und Eisenring angeschleppt, kann man als eine Anspielung auf Gefahren verstehen, die die ganze Menschheit bedrohen, aber mehrheitlich ohne Gegenwehr akzeptiert werden. Giftgase z.B. existieren noch immer in Munitionsdepots, deren Verwendung ist aber vertraglich verboten und deren Vernichtung zeitlich geplant. Es regt sich aber keine breite Masse darüber auf, wenn deren Beseitigung nicht eingehalten wird. Als die Polizei die Nachricht von Knechtlings Tod überbringt, erklärt Biedermann die Brandstifter zu seinen Mitarbeitern und deklariert das gefährliche Benzin als harmloses Haarwasser. Das Bürgertum geht mit dem Bösen ein Komplott ein, da beide Angst vor dem Gesetz haben. Biedermann ist von seinem Handeln, er begehe kein Unrecht, so voreingenommen, dass er sich von seiner Umwelt abschottet und an keinen Stammtisch mehr geht. Alle Warnungen ignoriert er und hält stattdessen weiterhin zu den Brandstiftern. Ein bisschen Vertrauen muss man schon haben, ein bisschen guten Willen. Biedermann will mit einem festlichen Mahl die Freundschaft der Brandstifter gewinnen. Während er die Einladung überbringt, pfeift Eisenring, der weiterhin am Untergang des Hausherrn arbeitet, Lili Marlen. Lili Marlen war im 2. Weltkrieg ein bekanntes Lied, das zur Aufmunterung der Soldaten diente. Hier wird deutlich, dass Biedermann und die Brandstifter im Kriegszustand sind und eine wahre Freundschaft nicht gefunden werden kann. Nach der Einladung taucht der Dr. phil. auf. Er ist der einzige, der einen wahren Sinn in der Brandstiftung sieht. Dies wird durch die Charakterisierung des Chores klar: Sieht er in Fässern voll Brennstoff nicht Brennstoff Er nämlich sieht die Idee! Er versucht mit Gewalt die kranke, schlechte Seite der Gesellschaft zu vernichten. Hier wird der Bezug zum Terrorismus deutlich, denn der Zweck heiligt die Mittel. Max Frisch, der auf seinen Reisen sicherlich verschiedene Arten des Terrorismus kennengelernt hat, bringt seine persönlichen Erfahrungen durch den Dr. phil. in das Stück ein. Der Dr. phil. stellt jedoch leider zu spät fest, dass Schmitz und Eisenring nur das radikal Böse und die Freude bzw. die Lust an der Zerstörung sehen und distanziert sich von den beiden. Parallelen sind in der Entstehung von terroristischen Splittergruppen zu sehen. Das von Biedermann einberufene Abendessen stellt eine wichtige Schlüsselszene dar. Es ist vergleichbar mit dem Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern. Für Biedermann und Babette bedeutet die Mahlzeit das letzte Zusammensein mit ihren vermeintlichen Freunden vor dem Tode. Während Biedermann mit Eisenring auf dem Dachboden ist, erscheint die Witwe Knechtling als Schwarze Witwe, Frisch dramatisiert hier zunehmend den Verlauf des Stückes. Diesen Verlauf erkennen wir als Todeskurve. Denn der Tod wird Biedermann bald holen. Eisenring will die Einladung nicht auf morgen verschieben, denn morgen sind sie nicht mehr hier. Während des Abendmahls spielt Schmitz eine Szene aus Hofmannthals Jedermann, indem er als Gespenst den Geist des toten Knechtling verkörpert. Nach dem Essen gibt Biedermann den Brandstiftern auf deren Bitte hin die Streichhölzer, die seinen Untergang endgültig beschliessen. Biedermann und die Brandstifter ist sehr wohl ein Lehrstück. Die Lehre, dass das Böse keinesfalls unabwendbares Schick sal ist, erkennt jeder. Doch in den Augen Frischs hat es für die Menschheit, wie für Biedermann, keine Lehre. Denn jeder ist wie Biedermann, er erkennt das Böse, will diese Erkenntnis nicht wahrhaben und wird immer wieder falsch handeln. Der Mensch wird stets den Weg des geringsten Widerstands gehen, auch wenn es ihn sein Leben kosten kann. Abschliessend stellt sich die Frage, ob Frisch mit seiner Meinung: Die Dummheit stirbt nie aus, recht behält. Oder wird der Mensch die Dummheit jemals besiegen können? Biedermann ist zu bequem und zu ängstlich, um gegen die Mächtigeren anzutreten, weil er grosse Angst vor den möglichen Konsequenzen hat. Aus diesem Grund hat Max Frisch dem Buch auch den Untertitel „Lehrstück ohne Lehre gegeben. Als Schmitz erst einmal Asyl hat, gibt er auch ganz offen zu, was er vorhat, und er erklärt Biedermann präzise seinen Plan. Doch in scheinbar naivem Idealismus, hinter dem sich Biedermanns Angst verbirgt, deutet er alle Vorbereitungen zur Brandstiftung als Scherze oder Mutproben und duldet sie. Was nicht sein darf, das wird auch nicht sein, denn ihm würde das nie passieren, dass jemand, den er so aufopfernd aufgenommen hat, in seinem Hause Feuer legen wird. Er hat die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen und will das Schreckliche nicht wahrhaben. Bezug zum Nationalsozialismus Das Drama kann als Bezug auf die Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland unter Adolf Hitler (1889–1945) verstanden werden. So lassen sich Parallelen zwischen dem Vorgehen der Brandstifter und dem der Nationalsozialisten erkennen: Ähnlich den Brandstiftern legte auch Hitler früh seine politischen Ziele offen, unter anderem in seinem Werk „Mein Kampf. Obwohl die Radikalität des Nationalsozialismus und die von ihm ausgehende Gefahr vielen Bürgern und Politikern im damaligen Deutschland bewusst war, wehrte sich ein grosser Teil von ihnen – wie Gottlieb Biedermann im Drama – nicht gegen die drohende Gewalt. Biedermann hilft Eisenring sogar, die Zündschnur zu vermessen, und trägt so aktiv zu seinem eigenen Unglück bei. In ähnlicher Weise gewann der Nationalsozialismus zunehmend die Unterstützung aus dem Volk, das Hitlers NSDAP 1933 mit relativer Mehrheit in den Reichstag wählte. Gleich dem Feuer, das Biedermann in seinem Haus umkommen lässt, kosteten schliesslich der von den Nationalsozialisten begonnene Zweite Weltkrieg und der Holocaust Millionen Menschen das Leben. In diesem Sinn kann in Biedermann ein Beispiel für die Gutgläubigkeit, die Bequemlichkeit, die Feigheit und oder die mangelnde Weitsicht vieler Deutscher gesehen werden, die aktiv oder passiv den Nationalsozialismus unterstützten. In der Tat lässt sich somit folgendes Zitat bestätigen: „Scherz ist die drittbeste Tarnung. Die zweitbeste: Sentimentalität. Aber die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. (Eisenring in Biedermann und die Brandstifter) Bezug zur Atombombe Auch zur Atombombe kann man eine gewisse Parallele sehen. Biedermann akzeptiert die Fässer voller Benzin auf dem Dachboden, weiss von der möglichen und zerstörenden Gefahr, welche von ihnen ausgeht und denkt sich dennoch nichts Böses dabei. Seine Gleichgültigkeit und eine schwächliche Bequemlichkeit verhindern konsequentes Handeln in dieser Situation. Auf die heutige Gesellschaft lässt sich dieses Schema leicht übertragen (die ganze Umweltproblematik mit der Erwärmung und deren fatalen Folgen, Ozonloch, Luft, etc.)