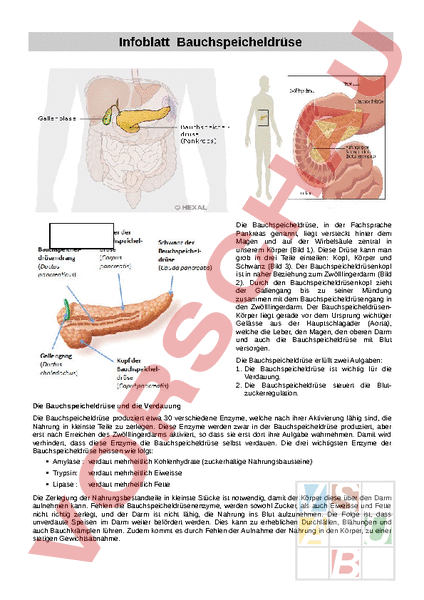Arbeitsblatt: Verdauungsorgane
Material-Details
Infoblätter zu Werkstatt Verdauungsorgane
Biologie
Anatomie / Physiologie
8. Schuljahr
7 Seiten
Statistik
96833
1305
19
01.04.2012
Autor/in
Jöri Allemann
Land: Schweiz
Registriert vor 2006
Textauszüge aus dem Inhalt:
Infoblatt Bauchspeicheldrüse Die Bauchspeicheldrüse, in der Fachsprache Pankreas genannt, liegt versteckt hinter dem Magen und auf der Wirbelsäule zentral in unserem Körper (Bild 1). Diese Drüse kann man grob in drei Teile einteilen: Kopf, Körper und Schwanz (Bild 3). Der Bauchspeicheldrüsenkopf ist in naher Beziehung zum Zwölffingerdarm (Bild 2). Durch den Bauchspeicheldrüsenkopf zieht der Gallengang bis zu seiner Mündung zusammen mit dem Bauchspeicheldrüsengang in den Zwölffingerdarm. Der BauchspeicheldrüsenKörper liegt gerade vor dem Ursprung wichtiger Gefässe aus der Hauptschlagader (Aorta), welche die Leber, den Magen, den oberen Darm und auch die Bauchspeicheldrüse mit Blut versorgen. Die Bauchspeicheldrüse erfüllt zwei Aufgaben: 1. Die Bauchspeicheldrüse ist wichtig für die Verdauung. 2. Die Bauchspeicheldrüse steuert die Blutzuckerregulation. Die Bauchspeicheldrüse und die Verdauung Die Bauchspeicheldrüse produziert etwa 30 verschiedene Enzyme, welche nach ihrer Aktivierung fähig sind, die Nahrung in kleinste Teile zu zerlegen. Diese Enzyme werden zwar in der Bauchspeicheldrüse produziert, aber erst nach Erreichen des Zwölffingerdarms aktiviert, so dass sie erst dort ihre Aufgabe wahrnehmen. Damit wird verhindert, dass diese Enzyme die Bauchspeicheldrüse selbst verdauen. Die drei wichtigsten Enzyme der Bauchspeicheldrüse heissen wie folgt: • Amylase verdaut mehrheitlich Kohlenhydrate (zuckerhaltige Nahrungsbausteine) • Trypsin: verdaut mehrheitlich Eiweisse • Lipase verdaut mehrheitlich Fette Die Zerlegung der Nahrungsbestandteile in kleinste Stücke ist notwendig, damit der Körper diese über den Darm aufnehmen kann. Fehlen die Bauchspeicheldrüsenenzyme, werden sowohl Zucker, als auch Eiweisse und Fette nicht richtig zerlegt, und der Darm ist nicht fähig, die Nahrung ins Blut aufzunehmen. Die Folge ist, dass unverdaute Speisen im Darm weiter befördert werden. Dies kann zu erheblichen Durchfällen, Blähungen und auch Bauchkrämpfen führen. Zudem kommt es durch Fehlen der Aufnahme der Nahrung in den Körper, zu einer stetigen Gewichtsabnahme. Infoblatt Enzyme Enzyme bewirken die chemische Verdauung Ein Käsebrötchen, das zum Frühstück gegessen wird, enthält alle wichtigen Nährstoffe: Der Käse liefert Proteine, das Brötchen Kohlenhydrate und Butter oder Margarine enthalten Fette. Was geschieht mit den Nährstoffen im Körper, nachdem ein Stück vom Brötchen abgebissen wurde? Die Nahrung wird in unserem Körper durch zahlreiche mechanische und chemische Prozesse bearbeitet. Dies ist notwendig, weil die in der Nahrung enthaltenen Nährstoffe nicht direkt zur Energiegewinnung und zum Aufbau von Körpersubstanz genutzt werden können. Proteine, Kohlenhydrate und Fette sind grosse, wasserunlösliche Kettenmoleküle, die aus vielen kleinen Bausteinen aufgebaut sind. Im Körper müssen sie zunächst in ihre kleinen, wasserlöslichen Bestandteile zerlegt werden. Diesen Vorgang der Zerlegung nennt man Verdauung (chemische Verdauung). Er erfolgt mithilfe besonderer Wirkstoffe, der Enzyme. Enzyme kommen in unserem gesamten Körper vor. Sie regulieren und beschleunigen chemische Prozesse, ohne dabei selbst verändert zu werden. Wie eine Schere beim Schneiden sich nicht verändert. Enzyme sind aber spezialisierte Wirkstoffe. Sie können nur einen bestimmten Prozess regulieren. Bei der Verdauung braucht es also für die verschiedenen Nährstoffe und für die unterschiedlichen Abbauschritte von langen Kettenmoleküle zu kleinen Bestandteilen viele verschiedene Enzyme. Die Zerlegung der Nährstoffe beginnt bereits im Mund. Die Speicheldrüsen produzieren täglich ca. 1,5 Liter Speichel. Er enthält die Enzyme Amylase und Ptyalin. Sie spalten die wasserunlöslichen, langkettigen Stärkemoleküle in kürzere, wasserlösliche Malzzuckerteilchen (Maltose) auf. Fette und Proteine werden im Mund noch nicht verdaut. Durch die Speiseröhre gelangt der Speisebrei jetzt in den Magen. Hier sondern Drüsen in der Magenschleimhaut pro Tag etwa zwei Liter Magensaft ab. Dieser enthält u. a. Schleim, Salzsäure und das Enzym Pepsin. Die im Magensaft enthaltene 0,5%ige Salzsäure säuert den Mageninhalt an. So werden mit der Nahrung aufgenommene Bakterien abgetötet. Gleichzeitig lässt sie Proteine aufquellen und vergrößert dadurch deren Oberfläche. Nun kann das Pepsin mit der Zerlegung der Proteine beginnen. Proteinmoleküle sind aus Hunderten von Aminosäuren aufgebaut. Pepsin zerlegt die langkettigen Proteinmoleküle jetzt in kurze Bruchstücke, die Peptide. Die Zellen der Magenschleimhaut enthalten wie alle Körperzellen Proteine. Warum verdaut sich der Magen nicht selbst? Der von der Magenschleimhaut produzierte Magenschleim schützt die Magenwände vor Salzsäure und Pepsin. Ist dieser Schutz beispielsweise durch erhöhten Alkohol- oder Nikotinkonsum gestört, kann es zu einer Magenschleimhautentzündung oder zu Magengeschwüren kommen. Portionsweise gelangt nun der Nahrungsbrei in den ersten Abschnitt des Dünndarms, den Zwölffingerdarm. Bauchspeicheldrüse und Leber leiten ihre Verdauungssäfte in den Zwölffingerdarm. Die Leber sondert eine Flüssigkeit ab, die Galle. Der Gallensaft lässt Fette emulgieren, d.h. zerteilt sie in kleinste Tröpfchen. Durch diese Oberflächenvergrößerung kann jetzt ein Enzym der Bauchspeicheldrüse, die Lipase, besser einwirken. Dabei wird Fett in Glycerin und Fettsäuren zerlegt. Bauchspeicheldrüse und Darmschleimhaut sondern noch weitere Enzyme ab. Trypsin zerlegt Peptide bis zu den Aminosäuren. Amylase setzt die im Mund begonnene Zerlegung der Stärke in Malzzucker fort. Diese Doppelzucker werden durch das Enzym Maltase in Traubenzucker (Glucose) zerlegt. Auch die häufig in der Nahrung vorkommenden Doppelzucker Rohrzucker und Milchzucker werden hier in Einfachzucker gespalten. Im Dünndarmsaft hat es weitere Enzyme, die alle Nährstoffe weiter abbauen. Die Nährstoffe sind jetzt in ihre Grundbausteine Aminosäuren, Glucose, Fettsäuren und Glycerin zerlegt. In dieser Form können nun Aminosäuren und Glucose durch die Darmwand ins Blut sowie Glycerin und Fettsäuren in die Gewebsflüssigkeit, die Lymphe, gelangen. Auf diese Weise stehen die Grundbausteine jetzt allen Zellen zur Energiegewinnung und für Aufbauprozesse zur Verfügung. Wirkung von Enzymen (beichemisch) Infoblatt Dickdarm Dickdarm Nährstoffe Durch die Produktion von Beitrag zu unserer Vier bis fünf Stunden nach einer Mahlzeit tritt der Dünndarminhalt, von einer kräftigen peristaltischen Welle getrieben, in den über. Bei normaler, gemischter Kost sind dann nahezu alle aus dem Darminhalt verschwunden. Sie wurden im Dünndarm in Blut und Lymphe resorbiert. Bei reiner Pflanzenkost sind hingegen noch erhebliche Nährstoffmengen in den schwer verdaulichen Pflanzenzellen zu finden. Dies kann im Dickdarm zu Gärung und Fäulnis führen, zumal der Endabschnitt des Dünndarms und der Dickdarm von vielen Darmbakterien besiedelt sind. Methan, Ammoniak und Schwefelwasserstoff entstehen. Vitamin leisten die Darmbakterien jedoch auch einen Ernährung. Im Dickdarm wird ein grosser Teil des Wassers, das mit den Verdauungssäften in den Darm abgegeben wurde, zurückgewonnen. Durch peristaltische Wellen, die gegen die normale Bewegungsrichtung verlaufen, wird der Darminhalt zunächst im Blinddarmbereich „festgestampft. Später wir er in unregelmässigen Schüben weiterbefördert und tritt schliesslich in den Mastdarm ein, den letzten Teil des Dickdarms. Dadurch kommt es zum Stuhldrang, der schliesslich zu einer lebhaften Peristaltik des Mastdarms führt. Der Kot kann aus dem After ausscheiden, sobald willentlich die Spannung des Schliessmuskels aufgehoben wird. Der Kot enthält noch etwa 65 bis 85% Wasser. 50% der Trockensubstanz sind Bakterien, zu 25% besteht sie aus abgeschilferten Darmwandzellen. Ähnlich einer inneren Haut des Körpers ist der Darm den Angriffen von Schad- und Giftstoffen, Pilzen, Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen ausgesetzt. Bei einer Dauerinvasion von Krankheitserregern wirken Darmzellen wie ein Schutzsieb. Sie stimulieren auch die Produktion von Immunzellen. Im Dickdarm wird der Darminhalt eingedickt, das Wasser wird zurück gewonnen. Der Blinddarm ist ein Anhangsteil der im rechten Unterbauch aufsteigenden Dickdarmschleife. Am Blinddarm befindet sich ein Anhängsel, der so genannte Wurmfortsatz (Appendix). Dieser Wurmfortsatz kann sich entzünden. Man spricht zwar von einer Blinddarmentzündung, korrekt ist aber, das es sich um eine Entzündung des Wurmfortsatzes handelt. Der Verlauf der Erkrankung kann von einer leichten Reizung über die akute Entzündung bis hin zur chronischen Appendizitis reichen. Der Mastdarm oder Rektum ist der letzte Abschnitt des Magendarmtraktes. Er wird deshalb auch als Enddarm bezeichnet und gehört zum Dickdarm. Der Mastdarm ist circa 15-20 cm lang, wobei die untersten 4 cm als Anus oder After bezeichnet werden. Der Mastdarm hat die Funktion den Stuhl zu lagern (Reservoirfunktion), anschliessend erfolgt die Ausscheidung über den Anus. Ein komplizierter Verschlussmechanismus (Beckenbodenmuskulatur; Schliessmuskeln und Haemorrhoidalpolster) regulieren die Stuhlentleerung. Infoblatt Dünndarm Die Hauptaufgabe des Dünndarms ist die weitere Spaltung des Nahrungsbreis in seine kleinsten Bestandteile und die Aufnahme (Resorption) dieser Bestandteile durch die Darmschleimhaut ins Blut und Lymphe. Der Dünndarm mit einer Länge von 4-6 verbindet Magen und Dickdarm. Er gliedert sich in drei Abschnitte: Zwölffingerdarm, Leerdarm und Krummdarm. Zwölffingerdarm ist ca. 25-30cm lang. Er ist der erste kurze Abschnitt des Dünndarms. Er hat die Form eines Quergestellten U. Dieses legt sich um den Kopf der Bauchspeicheldrüse. Leerdarm 2/3 vom Dünndarm. Er befindet sich vorwiegend in der linken Hälfte der Bauchspeicheldrüse. Der Leerdarm liegt frei im Bauchraum. Krummdarm 3/5 vom Dünndarm. Er bildet den letzten Teil des Dünndarms und mündet in den Dickdarm. Der Leerdarm liegt frei im Bauchraum. Bau des Dünndarms Der Durchmesser misst 3 bis 4 cm. Der Dünndarm ist oft gewunden. Diese Windungen machen es möglich, dass die Länge des Darms einen relativ kleinen Raum in der Bauchhöhle einnehmen. Wäre unser Darm innen ein glattes Rohr, hätte er eine Oberfläche von gerade mal 0,33 m2. Aber die reale innere Oberfläche beträgt ein Vielfaches. Wie ist das möglich? Der Dünndarm zeigt als Anpassung an seine Funktion der Nährstoffaufnahme eine stufenweise Vergrösserung der inneren Oberfläche. Wie du im Schema rechts siehst, ist die Schleimhaut des Dünndarms innen ringförmig gefaltet. Diese Falten sind mit rund 4 Millionen Zotten versehen. Das sind 1 mm lange Ausstülpungen der Schleimhaut. Auf 2 1 cm Darmoberfläche kommen 2000 bis 3000 Darmzotten. Die Zotten selbst sind noch einmal durch Mikrozotten vergrössert. Dabei handelt es sich um weitere kleine Ausstülpungen, die den Bürstensaum bilden. Auf 1 mm2 Darmoberfläche kommen rund 200 Millionen Mikrozotten. So kommt die Oberfläche des Dünndarms statt auf 0,33 m2 zu etwa 2000 m2. Oberflächenvergrößerung im Dünndarm (schematische Darstellung) Größe der Oberfläche (in m2) innerer Oberfläche äußere Oberfläche 0.33 1:1 1 3:1 40 30 1 2000 6000 1 Aufgabe des Dünndarms Der Dünndarm spielt bei der weiteren chemischen Verdauung und Aufnahme von Nährstoffen die entscheidende Rolle. Im Zwölffingerdarm werden dem Nahrungsbrei die von der Leber und der Bauchspeicheldrüse produzierten Verdauungssäfte zugeführt und die Magensäure neutralisiert. Dabei wird die Nahrung weiter in ihre Nahrungsbestandteile zerlegt. Durch die Schleimhaut der Darmzotten im Leer- und Krummdarm (Gekrösedarm) werden die Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine, Salze und Spurenelemente ins Blut und Lymphe aufgenommen (Resorption). 1 Zellen, die einzelne Nährstoffbestandteile passieren lassen 2 Becherzellen, die Schleim bilden 3 Teppich aus Mikrozotten 4 Muskelzellen ermöglichen pumpende Bewegung der Zotten 5 Arterienhaargefässe (dünne Blutgefässe) – rot 6 Venenhaargefässe (dünne Blutgefässe) – blau 7 Lymphhaargefässe (dünne Lymphgefässe) Resorption Kohlenhydrate als Traubenzucker Fette als Fettsäuren und Glyzerin Proteine (Eiweisse) als Aminosäuren Dünndarm Schleimhaut der Darmzotte Blutbahn und Lymphe Infoblatt Niere Die Nieren befinden sich an der hinteren Wand des Bauchraumes in der Lendengegend. Die Aufgaben der Nieren ist es Blut und Lymphe zu reinigen. Sie sind ein kompliziertes Filtersystem. Man kann sie als die Kläranlage des Körpers bezeichnen.